
Safran
(Crocus Sativus L.)
Safran - eines der teuersten Gewürze der Welt - gewinnt man aus der Krokuspflanze Crocus Sativus L., die seit 1762 durch Carl von Linée unter ihrem botanischen Namen bekannt ist. (Abb. 1) Crocus Sativus gehört zur Familie der Schwertliliengewächse und zur Gattung der Krokusse und ist von den wilden Safrankrokusarten zu unterscheiden. Crocus Sativus ist eine mehrjährige, triploide Pflanze, die sich ausschließlich vegetativ vermehrt. Aufgrund der vegetativen Vermehrung basiert der Anbau immer noch auf traditionellem Wissen. Sie ist herbstblühend und beginnt nach dem ersten Kälteimpuls ca. Ende September/Anfang Oktober mit dem Wachstum und der Blütephase. Aus einer Knolle wachsen in der Regel bis zu drei, mitunter fünf Blüten.[1] Der Safrankrokus zeichnet sich durch grasartige Blätter aus und bildet im weiteren Verlauf einen violetten Blütenkelch, in dem sich ein Griffel mit drei roten Narben befindet. Die roten Narben bilden den kostbaren Safran.
Der gesamte Ernteprozess erfordert viel Handarbeit (Abb. 1), wie ein Bericht Ende des 18. Jahrhunderts anschaulich beschreibt: “Die blauen Blumen, wenn sie sich geöffnet, kann man Fruh und Abends sammt dem Saffran abzupfen; die Saffranblümlein selbsten aus den Blumen nehmen, und auf Papier trocknen.“[2] (Abb. 2)
Die Kultivierung des Safrans im Mittelmeerraum gab es schon zu Zeiten der Ägäischen Bronzezeit vor über 3000 Jahren. Zeugnis für den frühen Safrananbau findet man auf Fresken.[3] (Abb. 3) Die Pflanze stellt keine außergewöhnlichen Bedingungen an Boden und Standort, trotzdem schwankte die Intensität der Kultivierung über die Jahrtausende.
Besonders in der Antike erfreute sich der Safran großer Beliebtheit, und fand nicht nur als Gewürz Verwendung, sondern diente auch zum Färben von Gewändern, als Kosmetikum oder als Duftstoff in römischen Bädern.[4] Mit der arabischen Expansion begann der Safrananbau vor allem in Frankreich, Spanien und Italien wieder an Bedeutung zu gewinnen. Die italienische Provinz L‘Aquila entwickelte sich zu einem Zentrum des Safranhandels,[5] und besonders im Wien des 13. bis 15. Jahrhunderts und später auch im niederösterreichischen Sankt Pölten florierte der Handel.[6] (Abb. 4) Im Mittelalter etablierte sich der Safrananbau auch wieder in deutschen Territorien; unter anderem entlang des Rheins, in der südlichen Pfalz, in Sachsen, vereinzelt in Bayern sowie bei Altenburg in Thüringen.[7] In England wurde sogar das Örtchen „Saffron Walden“ nach der kostbaren Ware benannt, das zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert als Zentrum des englischen Anbaus galt.[8]
„Safranschmierer“ und ihre Strafen
Wegen seines hohen Wertes – insbesondere als Arzneimittel und Heilpflanze.[9] - wurde Safran häufig gefälscht. In gemahlener Form streckte man ihn zum Beispiel mit Sandelholz oder man gab ähnlich aussehende gelbe Pulver aus Kurkuma, Arnika oder Färberdistel als Safran aus. In der Antike wurden Safranfäden in Honig oder Most einlegt, oder mit Olivenöl bedampft, um das Handelsgewicht zu erhöhen. Um der Betrügerei Herr zu werden, verhängte man im 15. Jahrhundert in Nürnberg drakonische Strafen gegen Fälscher. Die sogenannten „Safranschmierer“ wurden bei lebendigen Leib begraben oder samt gefälschter Ware auf dem Scheiterhaufen verbrannt.[10]
Safran in der Küche und Kochbüchern
Mit dem Aufschwung des Safrananbaus im Mittelalter erfreute sich Safran zur Färbung von Speisen und als Geschmackskomponente zunehmender Beliebtheit in der europäischen Küche. Denn wer es sich leisten konnte, verfeinerte damit seine Speisen.[11]
Ganz im Sinne Shakespeares, der in „Winters Tale“ schrieb „I must have saffron to color the warden pies“[12] – entdeckt man in historischen Kochbüchern reichlich Speisen mit Safran. In Deutschland erschien 1581 das erste Kochbuch für professionelle Köche von Marx Rumpolt. In über 100 Rezepten findet der Safran in salzigen und süßen Rezepten Erwähnung.[13] Ebenso verhält es sich im Kochbuch des kurfürstlich-sächsischen Hofküchenschreibers Johann Deckhardt von 1611.[14] In den Rezepten aus Anna Weckers Kochbuch von 1598, das sich vor allem an eine städtisch-gutbürgerliche Schicht richtete, ist Safran Bestandteil von Gerichten wie „Ein gut gebachens von Aepffeln“.[15] Ende des 19. Jahrhunderts war „das goldene Zeitalter des Safrans als Küchengewürz“ jedoch vorbei.[16]
Safran in Gartenbüchern und Gärten
Obwohl der Safran in der Küche an Bedeutung verlor, blieb sein Anbau in Küchengärten bis ins 19. Jahrhundert erhalten. Verschiedene Gartenbüchern enthalten detaillierte Anleitungen zur Kultivierung von Safran.[17] (Abb. 5) So zum Beispiel im 1822 erschienenen Gartenbuch des Dresdener Gärtners Traugott Jacob Seidel „Der Küchen-Gemüß-Gärtner oder deutliche Anweisung wie auf die leichteste und zweckmäßigste Art ein Küchengarten zu bestellen“ oder im 1793 anonym erschienenen Traktat „Der ökonomische Küchengarten“.[18] Schon im Handbuch „New Principles of Gardening“ des englischen Gartenkünstlers Batty Langley von 1728 findet man ausführliche Hinweise für die Kultivierung des Safrankrokus.[19] Neben größeren Plantagen darf man also davon ausgehen, dass der Safrankrokus auch schon früh in privaten Küchengärten zu finden war, wie beispielsweise im Küchengarten des Politikers James Johnstone of Twickenham (1643-1737) in England.[20]
Heute wird der Safranmarkt weltweit von Iran dominiert, der über 90 Prozent der Produktion stellt. Als zweitgrößter Produzent gilt Afghanistan. Dennoch gibt es in Europa wieder vermehrt Bemühungen, den Safrananbau zu beleben. Gegenwärtig erblüht der Safrananbau in der Schweiz, Österreich, in Altenburg in Thüringen oder im Küchengarten des Schlossgartens Eutin. (Abb. 6&7) Denn es gilt auch heute: „Ueber alles ist der Saffran eine schöne und seltene Zierde der Gärten, und dessen Sammlung für jede Standesperson ein annehmlicher, nüzlicher Zeitvertreib.“[21]
Christina Würtenberger
Verwendete Literatur:
[1] Durrer, Sandra; Durrer, Urs: Safran. Das rote Gold. Anbau/Geschichte/Handel/Rezepte, Aarau & München 2020, S. 15, 16.
[2] Wagner, Lucas Friedrich: Der Wiener Safran und der Spalter Hopfen in Baiern, München 1783, S. 27, 28.
[3] Seyyedeh-Sanam (u.a): Ancient Artworks and Crocus Genetics Both Support Saffron’s Origin in Early Greece, Frontiers in Plant Science, Volume 13 (2022), S. 2-4 [https://doi.org/10.3389/fpls.2022.834416]; Vgl. zur regional unterschiedlicher Ausbreitung in Europa: Kronfeld, Ernst Moritz (u.a.): Geschichte des Safrans (Crocus sativus L. var. culta autumnalis) und seiner Cultur in Europa, Wien 1892, S. 31-52.
[4] Basker, D., Negbi, M.: Uses of saffron. Econ Bot 37, (1983), S. 228-236 [https://doi.org/10.1007/BF02858789]
[5] Ebd. S. 231.
[6] Alt-Wien. Monatschrift für Wiener Art und Sprache, Band 4, Wien 1895, S. 127-129; Petrak, Ulrich: Praktischer Unterricht den niederösterreichischen Safran zu bauen, Wien 1797, S. 8; Kronfeld, Wien 1892
[7] Durrer & Durrer, 2020, S. 43.
[8] Ebd. S. 122.
[9] s. Bsp.: Bock, Hieronymus: New Kreütter Buch, Straßburg 1539; Gerard, John: The herball, or, Generall historie of plantes, London 1636, S. 151-164; Abel, Heinrich Kaspar: Wohlerfahrner Leib-Medicus der Studenten, Leipzig 1699, S. 173, 174.
[10] Basker & Negbi, 1983, S. 232., Durrer & Durrer, 2020, S. 61-64.
[11] Durrer & Durrer, Aarau & München 2020, S. 61, S. 176, 177-179.
[12] Basker & Negbi, 1983, S. 231.
[13] Rumpolt, Marx: Ein new Kochbuch. Frankfurt (Main), 1581, S. Ib.
[14] Deckhardt, Johann: New/ Kunstreich und Nützliches Kochbuch, Leipzig 1611
[15] Wecker, Anna: Ein Köstlich new Kochbuch Von allerhand Speisen/ an Gemüsen/ Obs/ Fleisch/ Geflügel/ Wildpret/ Fischen vnd Gebachens, hrsg. v. Katharina Taurellus, Amberg 1598
[16] Vgl. Kronfeld, Wien 1892, S. 42.
[17] Seidel, Traugott Jacob: Der Küchen-Gemüß-Gärtner oder […], Dresden 1822, S. 150,151; Kleemann, C.H.: Kurze und gründliche Anweisung zur Kultur der beliebtesten Zwiebelgewächse, Glogau [u.a.] 1828, S. 41, 42; Allgemeines Teutsches Garten-Magazin, Weimar 1806, S. 376-379; Blotz, J.F.: Die Gartenkunst oder ein auf vieljährige Erfahrung […] Dritter Theil, Leipzig 1797, S. 260-268.
[18] Der ökonomische Küchengarten, Leipzig 1793, S. 34.
[19] Langley, Batty: New Principles of Gardening […], London 1728, S. 176-179.
[20] Langley, London 1728, S. 47; Gerard, London 1636, S. 151, 152; Phillips, Henry: The Companion for the Kitchen Garden. History of cultivated vegetables, Band 2, London 1831, S. 186, 187.
[21] Wagner, München 1783, S. 35.
Abbildungen:
Abb. 1) Eine Frau pflückt Krokus-Blüten, in: Tacuinum-Sanitatis-Manuskript Cod. Ser. n. 2644, fol. 40v, ca. 1390–1400, Österreichische Nationalbibliothek
Abb. 2) Kupfertafel aus: Wagner, Lucas Friedrich: Der Wiener Safran und der Spalter Hopfen in Baiern, München 1783, Bayerische Staatsbibliothek/ Sammlung „Bücher zu Bayern“
Abb. 3) Safran Sammlerin, Fresko, Akrotiri, Griechenland
Abb. 4) Bildtafel aus: Petrak, Ulrich: Praktischer Unterricht den niederösterreichischen Safran zu bauen, Wien 1797
Abb. 5) Tafel aus: Kronfeld, Ernst (u.a.): Geschichte des Safrans (Crocus sativus L. var. culta autumnalis) und seiner Cultur in Europa, Wien 1892, Österreichische Nationalbibliothek
Abb. 6) Foto vom 03.10.2024 ©Jörg Hunke, Küchengarten Schloss Eutin
Abb. 7) Foto vom 05.10.2024 ©Jörg Hunke, Küchengarten Schloss Eutin
PARTNER
- Bayerische Schlösserverwaltung
- Schlösserverwaltung Baden-Württemberg
- LandschaftsArchitektur Franz
- Walled Kitchen Gardens Network
- Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
- Staatliche Schlösser und Gärten Hessen
- Stiftung Schloss Eutin
- Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V.
- Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg e.V.
- ProSpecieRara Deutschland gemeinnützige GmbH
- Deutsche Stiftung Denkmalschutz
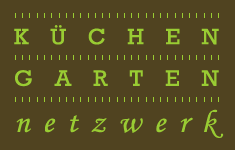
 Eine Frau pflückt Krokus-Blüten, in: Tacuinum-Sanitatis-Manuskript Cod. Ser. n. 2644, fol. 40v, ca. 1390–1400, Österreichische Nationalbibliothek.jpg)
 Kupfertafel aus: Wagner, Lucas Friedrich: Der Wiener Safran und der Spalter Hopfen in Baiern, München 1783, Bayerische Staatsbibliothek, Sammlung Bücher zu Bayern.jpg)
 Safran Sammlerin, Fresko, Akrotiri, Griechenland.jpg)
 Bildtafel aus: Petrak, Ulrich: Praktischer Unterricht den niederösterreichischen Safran zu bauen, Wien 1797.jpg)
 Tafel aus: Kronfeld, Ernst (u.a.): Geschichte des Safrans (Crocus sativus L. var. culta autumnalis) und seiner Cultur in Europa, Wien 1892, Österreichische Nationalbibliothek.jpg)
 Foto vom 03.10.2024 ©Jörg Hunke, Küchengarten Schloss Eutin.jpg)
 Foto vom 05.10.2024 ©Jörg Hunke, Küchengarten Schloss Eutin.jpg)